Zahl der Geburten in Niedersachsen in 2023 gesunken

Im Jahr 2023 wurden in Niedersachsen 67.162 Kinder lebend geboren. Wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) mitteilte, lag deren Zahl damit um 5,8% unter der des Vorjahres (71.289) und erreicht damit etwa das Niveau aus dem Jahr 2015 (67.183). Die höchste Geburtenziffer gab es in Salzgitter, die niedrigste in Oldenburg. Mit 1,42 ist die zusammengefasste Geburtenziffer in Niedersachsen zwar um 0,1 gesunken - im Ländervergleich aber zweithöchste zusammengefasste Geburtenziffer in Deutschland. Quelle und weitere Informationen: Landesamt für Statistik Niedersachsen, 21.08.2024, www.statistik.niedersachsen.de
Geburtenziffer 2023 auf 1,35 Kinder je Frau gesunken

Im Jahr 2023 kamen in Deutschland 692.989 Kinder zur Welt. Das waren 6 % Neugeborene weniger als im Jahr 2022. Weniger Kinder als im Jahr 2023 waren in Deutschland zuletzt 2013 geboren worden (682.069). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sank die häufig auch als Geburtenrate bezeichnete zusammengefasste Geburtenziffer 2023 gegenüber dem Vorjahr um 7 % von 1,46 auf 1,35 Kinder je Frau. Mütter waren bei der ersten Geburt durchschnittlich 30,3 Jahre alt, Väter 33,2 Jahre. Quelle und weitere Informationen: Statistische Bundesamt, 17.07.2024, www.destatis.de
Zahl der Geburten im Jahr 2023 auf niedrigstem Stand seit 2013

Im Jahr 2023 wurden in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen rund 693.000 Kinder geboren. Das waren 6,2 % weniger als im Vorjahr, wie Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Der Rückgang war somit etwas geringer als im Jahr 2022, als im Vorjahresvergleich 7,1 % weniger Babys geboren wurden. Die Zahl der Geburten sank damit auf den niedrigsten Stand seit 2013 (682.069), als zuletzt weniger als 700.000 Kinder zur Welt gekommen waren. Der Anteil der Geburten der dritten und weiteren Kinder erreichte trotz des aktuellen Geburtenrückgangs den Höchststand seit Beginn der Zeitreihe 2009. Quelle und weitere Informationen: Statistisches Bundesamt, 02.05.2024, www.destatis.de
Wie viele Kinder lebten 2022 in Niedersachsen?

Insgesamt lebten im Jahr 2022 1.922.000 Kinder in Niedersachsen mit ihren Familien zusammen, darunter knapp 1,4 Mio. Minderjährige, so das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN). Gut drei Viertel der noch nicht volljährigen Kinder wuchsen bei Eltern auf, die verheiratet waren. 9% hatten unverheiratete Eltern und 15% wuchsen mit nur einem Elternteil auf. 1,37 Mio. Kinder (71%) lebten mit Geschwistern in einem Haushalt. 6 von 10 Kindern hatten dabei nur eine Schwester oder einen Bruder, 4 von 10 Kindern hatten mehrere Geschwister. Mit 1.379.000 waren die meisten Kinder (71,8%) in niedersächsischen Familien minderjährig. In einem gemeinsamen Haushalt mit mindestens einem Elternteil lebten zudem rund 542.000 volljährige Kinder, davon waren fast ein Drittel (132.000 Personen) bereits 27 Jahre und älter. Quelle und weitere Informationen: LSN-Pressemitteilung, 29.09.2023, www.statistik.niedersachsen.de
Kinderreiche Familien in Deutschland
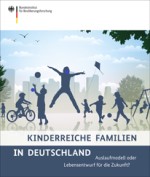
Eine Auswertung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) aus dem Jahr 2019 stellt kinderreiche Familien in den Mittelpunkt: Wer sind die Kinderreichen in Deutschland? Wo wohnen sie und in welchen Lebenslagen befinden sie sich? Der Statistikbericht aktualisiert den Erkenntnisstand über verschiedene Typen von kinderreichen Familien und ihre Lebenssituation in Deutschland. Kinderreiche Familien sind von verschiedenen Problemlagen betroffen. Sie sind zum Beispiel doppelt so häufig armutsgefährdet wie Familien mit weniger als drei Kindern und verfügen über weniger Wohnraum pro Person. Die Analyse der Lebensrealität von Frauen und Männern zeigt, dass die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern in Mehrkindfamilien traditionell ist. Kinderreiche Frauen sind zum Großteil in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt und deutlich häufiger nicht erwerbstätig als Männer. Sie investieren doppelt bis dreimal so viel Zeit in Kinderbetreuung und Hausarbeit. Durch das erheblich geringere Erwerbseinkommen sind viele ökonomisch abhängig vom Partner. Dies ist besonders problematisch, da die Kinder auch im Trennungsfall häufiger im Haushalt der Frauen leben.
Die Untersuchung stellt darüber hinaus die zunehmend komplexer werdenden Strukturen von kinderreichen Fortsetzungs- und Stieffamilien mit leiblichen Kindern, neuen Partnerschaften und Stiefkindern dar.
Download der Studie "Kinderreiche Familien in Deutschland. Auslaufmodell oder Lebensentwurf für die Zukunft?" von der Website des BiB.
Geburtenzahlen in Niedersachsen: kostenfreie Regionaldatenbank für Niedersachsen
Detaillierte räumlich und demographisch differenzierte Ergebnisse zu der Zahl der Lebendgeborenen in Niedersachsen können kostenfrei in der LSN-Online-Datenbank für Niedersachsen abgerufen werden.
Integrationsmonitoring: Migration und Teilhabe in Niedersachsen
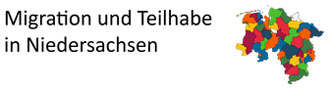
Zahlen zur Zuwanderung und zur Integration von Menschen mit eigener oder familiärer Zuwanderungsgeschichte bietet das Niedersächsische Integrationsmonitoring unter integrationsmonitoring.niedersachsen.de. Erstellt wird es durch das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) im Auftrag des Niedersächsischen Sozialministeriums. Niedersachsen ist seit je her ein Ziel für Zuwanderinnen und Zuwanderer. Die Migrationsanlässe und die Herkunft der Zuwandernden sind vielfältig und verschieben sich im Zeitverlauf. Die Menschen werden Teil der Gesellschaft und prägen sie hierdurch mit. Das Niedersächsische Integrationsmonitoring bietet die Grundlage für Bewertungen vieler Themenfelder und Sachverhalte und kann die Planung von Vorhaben unterstützen.