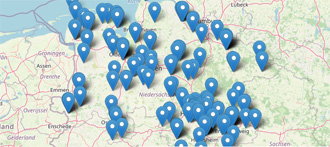Wie können Familienzentren – auch als Baustein von Präventionsketten – zur Armutsprävention beitragen? Diese Frage stand im Zentrum einer nifbe-Fachtagung, die im Rahmen eines von der Auridis Stiftung geförderten Projektes stattfand und auch einen umfangreichen Markt der Möglichkeiten anbot. Moderiert wurde die Tagung von nifbe-Transferwissenschaftlerin Anna Dintsioudi.
Zur Begrüßung wies nifbe-Familienzentrenkoordinatorin Sandra Köper-Jocksch auf die Zunahme von herausfordernden Lebenslagen und von Armut betroffenen Familien und Kindern in Deutschland hin. Die im Sozialraum und Kommune eng vernetzten Familienzentren seien dabei "ein idealer Ort für Armutsprävention" mit einer integrierten frühkindlichen Bildung sowie die Familien-Beratung und -Unterstützung. Sie dankte auch dem Niedersächsischen Sozialministerium, das seit diesem Jahr eine Landesweite Koordinationsstelle Familienzentren beim nifbe (co-) finanziert.
Andreas Böer vom Niedersächsischen Sozialministerium kennzeichnete in seinem Grußwort die Soziale Arbeit als ein entscheidendes Mittel, um Familien bei ihrem Weg aus der Armut zu unterstützen. Dabei gehe es einerseits um die Erwerbsbeteiligung der Eltern und in mittelfristiger Perspektive andererseits um den Bildungserfolg der Kinder. Ziel der Sozialen Arbeit und auch der Familienzentren als Orte der niedrigschwelligen Unterstützung und Beratung sei hier das "Empowerment".
Pina Nell von der Auridis Stiftung führte aus, dass Armut Familien in ganz unterschiedlichen Situationen betreffe und dass Familienzentren hier jeweils ideale Möglichkeiten für die Unterstützung und Teilhabe böten. Familienzentren seien wichtige Bausteine für eine wirksame Armutsfolgen-Prävention, müssten aber durch strukturelle Maßnahmen auf Landes- und Bundesebene flankiert werden. Pina Nell kündigte einen von der Auridis Stiftung aufgelegten Fonds für konkrete kleinere Maßnahmen der Förderung von Familien und Kindern in niedersächsischen Familienzentren an, der in Kürze startet und über das nifbe ausgeschüttet wird.
In ihrem Auftaktvortrag beleuchtete Christina Kruse von der LVG & AFS Nds. HB e.V auf der Grundlage eines Projektes zum Aufbau von Präventionsketten die strukturelle Armutsprävention und das Zusammenwirken von Politik, Verwaltung und Institutionen. Am Beispiel eines Cartoons zu kostenpflichtigen Zusatzangeboten in der KiTa näherte sie sich dem Thema der Armutssensibilität, die ein (sozial-) pädagogischer Anspruch sein müsse und mit einer empathischen, wertschätzenden und respektvollen Haltung verbunden sei. Ebenso benötigten Fachkräfte hierfür aber auch eine "selbstreflexive Professionalität" sowie einen vorurteilsbewussten und ressourcenorientierten Blick. Dahinter liegendes Ziel sei es, für armutsbetroffene Familien und ihr Kinder Zugänge zu schaffen und Teilhabe zu sichern.
Gravierende Entwicklungsrisiken und Langzeitfolgen
In theoretische Rahmung stellte die Fachreferentin die Auswirkungen von Armut nach dem Lebenslagen-Ansatz da. Demnach habe Armut Auswirkungen auf die materielle, soziale, kulturelle und gesundheitliche Lage der Betroffenen. Verbunden seien damit "gravierende Entwicklungsrisiken mit Langzeitfolgen". Von Armut betroffene Familien und ihre Kinder hätten häufig eine "hohe Belastung bei geringen Ressourcen" und sichtbar werde hier auch immer wieder ein "Präventionsdilemma": Diejenigen, die am meisten von Unterstützungsangeboten profitieren würden, nehmen sie nur wenig in Anspruch, weil die Zugänge fehlten oder sie nicht passgenau seien. Über strukturelle Präventionsketten könnten und müssten hier Barrieren abgebaut und Zugänge geschaffen werden. Politik, Verwaltung und Institutionen hätten hier eine "geteilte Verantwortung".
Christina Kruse hob Familienzentren als "wichtige Ankerpunkte einer strukturellen Armutsprävention" heraus und unterstrich ihr besonderes Potenzial als Schnittstelle zum Sozialraum und zur Kommune. Am Beispiel des Barsinghauseners Modell zeigte sie auf, wie strukturelle Armutsprävention aussehen kann. Aufgelegt wurde hier beispielsweise eine Qualifizierungsreihe für KiTas und Familienzentren zum Thema Armutsprävention und des Weiteren konnten Reflexionsrunden und kollegiale Beratung für Fachkräfte etabliert werden. Über einen Fonds im kommunalen Haushalt sind alle Angebote in der KiTa sowie das Frühstück für alle Kinder frei, so dass Eltern nicht mit zusätzlichen Kosten konfrontiert sind.
Wissen, Können, Haltung
Auf der Fachkraft-Ebene stellte Christina Kruse die Armutsprävention als "Prozess aus Wissen – Haltung – Handeln" dar. Beim Thema Wissen gehe es unter anderem darum, die häufig auch medial reproduzierten Vorurteile auszuräumen. Studien hätten so aufgezeigt, dass viele arme Eltern zum Beispiel einem geregelten Arbeitsalltag nachgehen und dass arme Eltern zuerst an sich selbst sparen und nicht an den Kindern. Ein Mythos sei es auch, dass arme Eltern mehr Zeit hätten als andere.
Abschließend zeigte die Referentin auf, was jede einzelne Fachkraft im Alltag konkret tun kann:
- Armutsbrille im Alltag aufsetzen
- Fragen und Zuhören
- Thema offensiv ansprechen
- Sich eigene Ziele setzen
- Mitstreiter:innen suchen
Auf den Zugang kommt es an!
Unter dem Titel "Auf den Zugang kommt es an!" zeigte Prof. Dr. Sarah Häseler von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin auf, wie niedrigschwellige Ansprache und Kontaktaufnahme in Familienzentren gelingen kann. Grundlage dafür bildete die wissenschaftliche Begleitung eines Modellprojekts im Berliner Bezirk Friedrichshain / Kreuzberg.
Vorab rahmte auch sie das Thema noch einmal kurz theoretisch und unterstrich: "Armutssensibilität ist Teil der Fachlichkeit und ein Qualitätsmerkmal professionellen Handelns." Verbunden sei sie mit einem gemeinsamen Werte-Fundament, dass auf Solidarität, Chancengerechtigkeit und Inklusion abziele. Armutsprävention unterteile sich dabei in eine persönliche, institutionelle und strukturelle Ebene.
Mit dem Zoom auf die institutionelle Ebene veranschaulichte die Professorin für Soziale Arbeit, wie ein Familienzentrum niedrigschwellige Zugänge bieten kann – und zwar schon vor dem ersten Zugang durch Präsenz auf öffentlichen Plätzen, Spielplätzen oder Märkten sowie die Einbindung von Schlüsselpersonen wie dem Bäcker oder Kioskbesitzer im Sozialraum. Im Eingangsbereich des Familienzentrums könne dann ein Aufsteller mit einem Wochenplan in leichter, inklusiver Sprache und der Angabe von Kosten oder geförderten Angeboten Neugier und Interesse wecken. Das gelinge ebenso wie durch Kleider- und Spielzeugtauschangebote oder Lebensmittelverteiler. Grundsätzlich wichtig seien barrierefreie Zu- und Eingänge.
Ein Mix aus Angeboten
Im Hinblick auf die institutionellen Angebote empfahl die Referentin einen Mix aus offenen Angeboten sowie Beratungs- und Bildungsangeboten. Wichtig seien aber auch Rückzugsmöglichkeiten und Ruheinseln. Offene Angebote könnten offene Treffs, Feste oder Frühstücks- und Mittagessenangebote sein. Aufgrund des oftmals beengten Wohnraums von Familien in Armutslagen würden sich besonders auch Bewegungs- und Spielräume oder Kreativangebote sowie die Nutzung von Außenanlagen anbieten.
Als Beratungsangebote führte sie u.a. Sozial-, Rechts-, Asyl- und Mieterberatung, aber auch Beratung zur Bildung und Teilhabe oder zum Gesundheitssystem an. Bildungsangebote könnten von Sprachkursen mit paralleler Kinderbetreuung über Gesundheitsförderung und Ernährungsbildung sowie kulturelle Angebote bis zur klassischen Weiterbildung reichen.
Aktive Beziehungsgestaltung
Als "A und O" für niedrigschwellige Zugänge und Teilhabe stellte Sarah Häusler aber auch die "aktive Beziehungsgestaltung der Fachkräfte" heraus. Hier komme es darauf an, sich Zeit zu nehmen und ansprechbar zu sein und dabei sensibel auf die jeweiligen Kontexte zu achten. Dafür sei die Reflexion im Team und das Einüben von Perspektivwechseln wichtig. Fachkräfte könnten über die Angebote des Familienzentrums selbst hinaus auch eine Lotsenfunktion in den Sozialraum und die Kommune übernehmen.
Mit den Fachvorträgen, einem Workshop-Panel rund um das Thema sowie einem vielfältigen Markt der Möglichkeiten zeigte der nifbe-Fachtag auf, dass Armutsprävention ein Querschnittthema für Familienzentren und auch KiTas sein muss. Hierbei kommt es einerseits auf das Wissen, Können und die Haltung der einzelne Fachkraft an, aber ebenso auch auf die Vernetzung im Sozialraum und die nachhaltige Einbindung in strukturelle kommunale Präventionsketten.