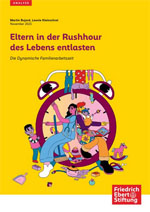Eltern leisten in der Rushhour des Lebens viel. Besonders in den Jahren, in denen Kinder klein sind, verdichten sich Erwerbs- und Sorgearbeit. Aktuelle Befunde zeigen deutlich: In der "Rushhour des Lebens" fehlt Eltern vor allem eines – Zeit. In dieser Phase entwickelt sich in vielen heterosexuellen Partnerschaften eine klare Arbeitsteilung: Mütter reduzieren ihre Erwerbsarbeit deutlich und dauerhaft, Väter arbeiten in dieser Phase deutlich mehr Stunden als gesellschaftlich ideal. Eine neue Analyse der Friedrich Ebert Stiftung (FES) zeichnet nach, wie sich die zeitliche Belastung von Eltern im Lebensverlauf entwickelt. Sie beleuchtet normative Vorstellungen und zeigt anhand aktueller Daten, was sich Familien wünschen und wie die Rushhour des Lebens entzerrt werden könnte. Im Zentrum steht der Vorschlag der Dynamischen Familienarbeitszeit.
Die Analyse zeigt: Zwischen Ideal und Realität klafft ein deutlicher Zeit-Gap, der sich mit dem Alter der Kinder verändert und langfristige Ungleichheiten prägt. Viele Eltern wünschen sich Rahmenbedingungen, die eine partnerschaftlichere Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit ermöglichen. Doch Arbeitsmarktrealitäten erschwerden dies weiterhin: Arbeitszeitreduktionen und Erwerbsunterbrechungen wirken sich weiterhin nachteilig aus. Der Wandel hin zu einem partnerschaftlichen Erwerbs- und Sorgemodell ist daher noch wenig fortgeschritten, der Gender-Care und der Gender-Working-Time-Gap weiterhin hoch.
Zentrale Erkenntnisse
Rushhour des Lebens
Eltern mit kleinen Kindern erleben in der "Rushhour des Lebens" eine hohe Belastung. Empirische Daten zeigen, dass Eltern mit mindestens einem Kind unter sechs Jahren regelmäßig über 60 Wochenstunden Gesamtarbeitszeit leisten und sich diese Belastung verringert, sobald das jüngste Kind älter wird. Diese Phase betrifft Eltern aller sozialen Gruppen und entsteht zunehmend häufiger, weil heute mehr Mütter erwerbstätig sind.
In Deutschland ist die Aufteilung von Erwerbs- und Care-Arbeit dennoch weiterhin stark geschlechtsspezifisch geprägt, insbesondere nach dem Übergang zur Elternschaft. Mütter übernehmen also nach wie vor einen deutlich größeren Anteil an Care-Arbeit und reduzieren ihre Erwerbstätigkeit, während Väter häufiger in Vollzeit erwerbstätig bleiben und seltener familiäre Aufgaben übernehmen.
Idealvorstellungen und Realität bei Erwerbsarbeitszeit
Der Vergleich von idealen und tatsächlichen Arbeitszeiten zeigt deutliche Diskrepanzen: In der Rushhour des Lebens arbeiten Väter im Schnitt deutlich mehr Stunden, als sie selbst oder die Gesellschaft für sinnvoll halten. Mütter hingegen reduzieren ihre Erwerbsarbeit nach dieser Phase weit stärker, als es den Idealvorstellungen der jungen und mittleren Generation entspricht. Das führt zu langfristiger ökonomischer Abhängigkeit, geringeren Rentenansprüchen und einem ungenutzten Fachkräftepotenzial auf dem Arbeitsmarkt. Verschiedene Rahmenbedingungen hindern Eltern an der Umsetzung eines egalitären Erwerbs- und Sorgemodells.
Die Dynamische Familienarbeitszeit orientiert sich an den empirisch erfassten Wünschen und Idealen der jungen und mittleren Generation und fragt: "Wie wollen (angehende) Eltern denn wirklich leben?" Sie schließt unmittelbar an das Elterngeld an und fördert in Stufe 1eine partnerschaftlichere Aufteilung der Erwerbsarbeit im Korridor von 25 bis 32 wöchentlichen Arbeitsstunden mit einem Pauschalbetrag von etwa 180 Euro pro Person. Im Anschluss steht Stufe 2 der Dynamischen Familienarbeitszeit zur Verfügung. Dabei wird der gemeinsame Arbeitszeitkorridor dynamisiert auf 29 bis 34 Stunden, was mit einem Pauschalbetrag von 120 Euro kompensiert wird. Hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit und der Einfachheit sind nicht Einkommensersatzleistungen, sondern Pauschalbeträge ausgewählt, von denen einkommensschwache Familien besonders profitieren.